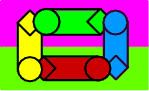Alfred Lang | University of Bern, Switzerland | 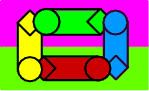 |
Edited Book Chapter 1977 (Revision from 1975) |
Diagnostikals ethisches Dilemma | 1977.01 @Ethic @DiffPsy @SciPolPrinc |
34 / 53KB Last revised 98.10.31 |
Pp. 190-202 in: Johannes K. Triebe & Eberhard Ulich (Hrsg.) Beiträge zur Eignungsgiagnostik. Bern, Huber, 1997 | © 1998 by Alfred Lang |
info@langpapers.org |
Scientific and educational use permitted |
Home || |
Aufgrund eines
Vortrages am Symposium "Krise der Diagnostik"' an der
Jahresversammlung der Schweizerischen Gesellschaft für
Psychologie am 12.April 1975 in Bern. Der unter dem Titel "Diagnostik
und Autonomie der Person" in der Schweizerischen Zeitschrift für
Psychologie 34, (3), 221-232, 1975 publizierte Text wurde teilweise
übernommen. Die Einleitung ist neu geschreiben und eine weitere
neue Passage ist vor dem Schluss eingefügt.
Psychodiagnostik ist wohl die
für einen Aussenstehenden am sichtbarsten gewordene Methode der
angewandten Psychologie. Sie ist zugleich ein Beispiel für die
relativ weitgehende Verselbständigung einer Methodik, man kann
schon sagen für die Hypertrophierung einer Methodik bei recht
eingeschränkter Beschäftigung mit ihren denkbaren und
realisierbaren Zielsetzungen sowie mit ihrer Einbettung in das Ganze
einer zugrundeliegenden Wissenschaf t. Aus der allgemeinen
Psychologie sind die folgenden Grundtatsachen bekannt und
unbestritten (vgl. etwa LEWIN, 1963, Kap. 10; LANG, 1964):
1. Das Handeln beruht zugleich auf inneren und äusseren Ursachen, d.h. es muss stets aus der gesamten Konstellation von personalen und situativen Merkmalen erklärt werden. 2. Jedes Individuum ist einmalig, da es sowohl aus seiner genetischen Anlage wie auch insbesondere aus der Kumulation der Erfahrungsgeschichte zu einer nicht wiederholbaren, einmaligen Konstellation personaler Merkmale kommt, die für das Handeln im je aktuellen Augenblick wirksam werden.
3. Die Entwicklung jedes Individuums ist zwar nach rückwärts in die Vergangenheit - im Prinzip - eindeutig bestimmbar, nach vorne in die Zukunft jedoch nur durch Erwartungsaussagen zu charakterisieren, deren Bestimmtheitsgrad mit zunehmender Entfernung von der Gegenwart abnimmt, weil durch nicht vorhersagbare weitere Erfahrungen die personalen Handlungsbedingungen zunehmend modifiziert werden und die Menge der beeinflussenden situativen Faktoren und deren Zusammenwirk-en zunehmend ungewiss sind.
Ich behaupte nun, dass sich die
psychologische Diagnostik in Theorie und Praxis weitgehend über
diese Grundtatsachen hinweggesetzt hat. Aus dem Versuch zur
diagnostischen Tätigkeit unter Missachtung dieser Grundtatsachen
resultiert ein Dilemma auf der ethischen Ebene, worauf hinzuweisen
das Ziel dieses Aufsatzes ist.
Zur ersten Grundtatsache, dem
Zusammenwirken personaler und situativer
Verhaltensbedingungen: Das Ziel der praktisch verwendbaren
diagnostischen Methoden ist fast ausschliesslich die Erfassung von
Merkmalen der Person und insbesondere von überdauernden
Merkmalen der Person, wie sie im Bemühen um
Stabilitätsmaximierung im Sinne der
Test-Retest-Reliabilität zum Ausdruck kommt. Einzig unter dem
Konzept der Inhaltsvalidierung von Tests ist ein rationaler Ansatz
entwickelt worden, die Übertragung der Testergebnisse auf die
Alltagssituation zu sichern; das Verfahren eignet sich fast nur
für einfache Leistungsprädiktionen. Die heftige Kontroverse
der letzten Jahre zwischen Personalisten und Situationisten scheint
sich endlich auf die einzig sinnvolle interaktive Konzeption hin
aufzulösen (BOWERS, 1973). Aber die neu gewonnene alte Weisheit
(STERN, LEWiN) hat noch kaum begonnen, sich auf Testkonstruktion und
Testpraxis auszuwirken. Trotz empirischen Belegen für die
Situationsspezifität vieler Variablen, dominieren immer noch die
aus klassischen Tests zusammengestellten Testbatterien zur Messung
personaler Dispositionen. Nur selten werden für die Lösung
eingegrenzter Probleme auf sorgfältiger Situationsanalyse
beruhende Verfahren vorgeschlagen (TRIEBE, 1975) oder entwickelt
(SPÖRLI, 1973).
Zum zweiten Argument, der
Einmaligkeitdes Individuums: jedes Individuum ist
einmalig; aber es kann in einem allgemeinen Beschreibungsraster
erfasst werden und prinzipiell sind allgemeine
Gesetzmässigkeiten anwendbar. Allerdings sind die
Beschreibungsverfahren in der Diagnostik stets
differentialpsychologische, d.h. die Skalen beruhen auf der
interindividuellen Variation des Verhaltens. Und die
Gesetzmässigkeiten sind bloss Regelmässigkeiten, d. h. sie
stellen statistische Zusammenhänge mit oft nicht sehr
eindrücklichem Bestimmtheitsgrad dar, welche wiederum aus der
interindividuellen Kovariation verschiedener Verhaltensvariablen
gewonnen worden sind. Die Konsequenz davon ist erstens, dass die
Beschreibung des Individuums immer auf die Eichpopulation der Skala
bezogen bleibt; das wird problematisch, wenn die untersuchten
Individuen nicht echte Mitglieder der Eichpopulation darstellen, was
bei dem raschen kulturellen Wandel und auch bei der häufigen
interkulturellen Übernahme der Tests eigentlich häufig
zutrifft. Die zweite Konsequenz scheint mir bedenklicher: bei
Regelmässigkeiten, wie sie alle unsere Validationsbefunde
darstellen, ist die Stellung eines gegebenen Individuums stets
ungewiss. In der Tat ist eine alte Einsicht der Logik, dass nie vom
Allgemeinen auf das Besondere geschlossen werden kann (vgl. auch
LEWIN, 1931). Sie wird in der Diagnostik des Individuums
regelmässig verletzt.
Die dritte Grundtatsache
betrifft das Individuum als ein genetisches Gebilde:
Diagnostik ist ihrem Wesen nach prädiktiv. Sie will nicht bloss
feststellen, sondern sie will feststellen im Hinblick auf etwas
anderes. Sie will die festgestellten Merkmale einer Konstellation
zusammen mit den oben genannten Gesetzmässigkeiten oder
Regelmässigkeiten interpretieren können in bezug auf eine
andere Konstellation, in der dasselbe Individuum Bestandteil ist.
Dabei interessieren selbstverständlich künftige
Konstellationen mehr als mit der Diagnose-Konstellation gleichzeitige
oder vergangene. Je weitreichendere Prädiktionen die Diagnostik
anstrebt -- Laufbahnvoraussichten, aktenkundige klinische Diagnosen
usw. --, desto mehr muss sie sich auf Merkmale beschränken, die
lebenslang konstant wirksam bleiben, also die sogenannten
Dispositionen der Person. Insofern hat sich die Diagnostik
zunächst folgerichtig den personalen Bedingungen zugewandt, aber
sie hat mit Unterstützung einer primitiven
Entwicklungspsychologie die Konstanz solcher Dispositionen mehr
dekretiert als nachgewiesen.
Bei aller Anerkennung der
Bedeutung der Konstanz der Person für Identität und
Selbstwert: genau so wesentlich für das Selbst ist die Erwartung
von Entwicklung, das Offensein für Unvorhersagbares. Das Problem
kompliziert sich durch die Tatsache der "Rückkoppelung": die
wissend vorweggenommene Entwicklung ist selbst eine
Einflussgrösse der Entwicklung. Einen Zeitgeist der Machbarkeit
der Zukunft unterstützend hat sich die Diagnostik ihre Ziele
unter Missachtung einer Grundtatsache des Lebendigen
aufgestellt.
Solche Überlegungen
können notgedrungen die Problematik nur andeuten. Es kommt mir
jedoch nur darauf an, deutlich zu machen, dass die psychologische
Diagnostik, vielleicht mehr noch die Theorie als die Praxis, mit
einigen wesentlichen Erkenntnissen ihrer Grundlagenwissenschaft in
Widerspruch steht. Die Frage stellt sich dann, ob man sie dennoch als
einen Zweig der Wissenschaft Psychologie, bzw. als eine ihrer
Anwendungen betrachten kann. Mit andern Worten, kann man die Praxis,
zu der man Diagnostik beizieht, als eine wissenschaftlich fundierte
ansehen, oder muss man der Diagnostik den Status irgendeiner
menschlichen Tätigkeit zuweisen, die ihre Rechtfertigung nur aus
sich selbst, aus ihren Leistungen, aus den Erfahrungen die man damit
gemacht hat, und aus dem "Kredit", den man ihr auf Grund solcher
Erfahrungen zubilligen will, bezieht?
Mir scheint nun, dass dieser
Schwebezustand der psychologischen Diagnostik zwischen Wissenschaft
und "Kunst" (MEILI, 1976) Folgen hat für die Verantwortung des
Diagnostikers. Diese sind nicht in allen Anwendungsbereichen gleich
gravierend. Es ist daher nötig, verschiedene Arten von
Diagnostik zu unterscheiden und darin die mögliche Rolle der
wissenschaftlichen und der anderen Vorgehensweise
aufzuzeigen.
Psychologische Diagnostik wird
immer im Hinblick auf das Treffen von Entscheidungen im Lebenslauf
von Individuen beigezogen. Sie wird meistens vom Treffen der
Entscheidungen selbst abgegrenzt und betrifft das irgendwie geregelte
Sammeln und Zusammenstellen oder Umformen von Daten über die
Individuen. deren Lebenslauf in Frage steht; bei gewissen Verfahren
wird die Entscheidung direkt mit ins Verfahren eingebaut (siehe
später). In den meisten Fällen wird Diagnostik eingesetzt,
um eine Entscheidung zwischen möglichen Alternativen des
Vorgehens (Verzweigung des Lebenslaufs), die prinzipiell auch anders,
beispielsweise zufällig oder willkürlich, getroffen werden
könnte, besser zu machen. Mit andern Worten, die Diagnostik
dient der Rechtfertigung von Entscheidungen. Dem Treffen voll
Entscheidungen vorausgehen kann eine heuristische Funktion der
Diagnostik: sie kann dazu beitragen, mögliche
Entscheidungsalternativen, die zunächst nicht erwogen worden
sind, überhaupt ins Blickfeld zu rücken; aber mit dem
Aufzeigen von Entscheidungsalternativen verbunden sind stets auch
schon die eigentlichen Entscheidungsunterlagen.
Besonders hinzuweisen ist noch
auf den Anwendungscharakter der Diagnostik: sie wird eingesetzt im
Hinblick auf Werte oder Ziele. Es gibt bessere und schlechtere,
günstigere und ungünstigere Entscheidungen im Lebenslauf,
und das naturgemäss beurteilt von einem bestimmten Standpunkt
aus. Oft sind mehrere Standpunkte mit unterschiedlichen Implikationen
für die Entscheidung möglich. Diese Wertungen sind selten
klar explizierbar, da sie ja ebenfalls zukünftige
Konstellationen betreffen.
Unter psychologischer
Diagnostik verstehe ich demgemäss das
geregelte Sammeln von Daten über Individuen derart, dass
Entscheidungen gerechtfertigt sind, welche den Lebenslauf, die
Entwicklung dieser Individuen,in intendierter Art
beeinflussen.
In dieser Definition stecken wenigstens vier Fragen, auf die ich
nun näher eingehen will:
- Wer intendiert die Beeinflussung des Lebenslaufs7
- Welche Art Daten werden gesammelt?
- Wie werden die Entscheidungen gerechtfertigt?
- Wer trifft die Entscheidungen?
Im Bewusstsein schrecklicher Vereinfachung versuche ich, jede
dieser Fragen mit zwei oder drei idealtypischen Antworten zu
versehen. Ich weiss, dass der konkrete Fall nie ausschliesslich im
einen oder im andern Typus untergebracht werden kann;
nichtsdestoweniger scheinen mir die Unterscheidungen geeignet,
gewisse grundlegende Paradigmata von Diagnostik herauszuarbeiten,
welche unterschiedliche ethische Implikationen haben.
Top of
Page
1. Wer intendiert die Beeinflussung des Lebenslaufs?
In Frage kommen der Proband selbst, der Diagnostiker oder ein
Dritter als Auftraggeber. In jedem Fall wird zwischen Proband und
Diagnostiker eine Art Kontrakt geschlossen, in den meisten
Fällen mehr implizit als explizit. Den Probanden interessiert
dabei wenig, in welch heiklem Verhältnis manchmal Auftraggeber
und Diagnostiker zueinander stehen. Für den Probanden ist
vielmehr entscheidend, ob er den Kontrakt mit dem Diagnostiker frei
von sich aus eingeht, oder ob ihm ein solcher Kontrakt von aussen
aufgezwungen wird. Es gibt völlig freie Kontrakte: der
Proband sucht den Berater auf und unterzieht sich dem von diesem
vorgeschlagenen diagnostischen Verfahren. Es gibt aber auch
völlig aufgezwungene Kontrakte. Legalistisch gesehen
mögen sie nicht allzu häufig sein (z.B. gerichtlich
angeordnete Begutachtung); im Erleben des Probanden sind sie aber
wohl nicht so selten, sei es in der klinisch-psychologischen
Diagnostik, in erziehungsberaterischen Abklärungen oder in
schulischen und betrieblichen Selektionsfragen. Immerhin dürfte
es angezeigt sein, eine dritte Kontraktform zu unterscheiden, den
bedingt freien Kontrakt, bei welchem der Proband freiwillig
ein bestimmtes Ziel anstrebt, zu dessen Erreichung er aber
gezwungenermassen die Bedingung einer diagnostischen Abklärung
eingehen muss.
2. Welche Art Daten werden gesammelt?
Selbstverständlich entscheidet der Diagnostiker auf Grund der
Fragestellung des Kontrakts darüber, was für Daten er
über den Probanden braucht und wie er sie erhebt. Es scheint mir
aber für das Verhältnis zwischen Proband und Diagnostiker
von entscheidender Bedeutung, ob der Diagnostiker seine Daten ad
hoc, d.h. aus seiner persönlichen Perspektive, sammelt, oder
ob der Diagnostiker seine Daten über den Probanden zu
rechtfertigen versucht, indem er Methoden verwendet, deren Ergebnisse
von seiner Person unabhängig sind. Also entweder Daten über
den Probanden, die dieser Diagnostiker allein durch seine Person
rechtfertigt, oder Daten, die objektiv, d.h. soweit reliabel
sind, als irgendein anderer Diagnostiker sie auch erheben
könnte.
Pulver (1975) plädiert für Sowohl-als-Auch, und, wenn
ich ihn richtig verstehe, für eine nicht wieder auflösbare
Vermengung der beiden Arten von Daten. Ohne zunächst dafür
oder dagegen Stellung nehmen zu wollen, möchte ich zu bedenken
geben, dass nach Vermengung die Gesamtdaten nur den Charakter von ad
hoc-Daten haben und mithin nur Schlüsse zulassen, die dieser
Diagnostiker allein durch seine Person rechtfertigen kann.
3. Wie werden die Entscheidungen gerechtfertigt?
In der Praxis sind oft Daten und Entscheidungen nicht sauber zu
trennen; manchmal werden auch mehrere zyklische Phasen des
Datensammelns und des Entscheidens durchlaufen (vgl. etwa Kaminski,
1970), was die Situation kompliziert. Aber zumindest begrifflich,
vielleicht besser auch praktisch, ist die Unterscheidung wichtig,
weil auf Grund derselben Daten verschiedenartige Entscheidungen oder
dieselben Entscheidungen auf unterschiedliche Weise oder durch
unterschiedliche Entscheidungsträger getroffen werden
können. Beispielsweise kann ein knappes Schulreifetestresultat
verbunden mit der Feststellung einer eher schwächlichen
Konstitution und verhältnismassig günstigen familiären
Verhältnissen zu durchaus unterschiedlichen
Einschulungsentscheiden führen: bei den Eltern, bei der
Kindergärtnerin, beim Schulpsychologen, bei verschiedenen
Schulpsychologen oder sogar beim selben Schulpsychologien, der im
Rahmen unterschiedlicher Tendenzen zweier Beratungsstellen arbeitet.
Aehnlich wie die Daten können auch die Entscheidungen nach dem
Grad der intersubjektiven Invarianz, mit der sie aus den Daten
hervorgehen, charakterisiert werden. Entweder sind die Entscheidungen
in den Daten als solchen enthalten und müssen nur unter Beizug
allgemeiner oder differentieller psychologischer
Gesetzmässigkeiten (z.B. in der Form von
Validitätsgleichungen) expliziert werden: man spricht dann von
aktuarischen Entscheidungen. Oder jemand muss die Daten
zusammen mit seinen persönlichen Erfahrungen in einem
intuitiv-klinischen Verfahren verarbeiten und so zu einer hier
und jetzt einmaligen Entscheidung kommen.
4. Wer trifft die Entscheidungen?
In Frage kommen der Proband selbst, der Diagnostiker, ein Dritter
oder ein automatisches Verfahren. Wieder ist es für den
Probanden von geringer Bedeutung, ob der Andere, der über ihn
entscheidet, der Diagnostiker selbst oder eine Drittperson ist.
Man kann also drei Antworten geben:
a) Der Proband bleibt autonom: es wird ihm vom Diagnostiker Information vorgelegt, die gesammelten Daten in ursprünglicher oder in verarbeiteter Form zusammen mit weiterem relevanten Material wie Bezugsnormen oder Erfahrungen anderer Personen; aber der Proband selber ist es, der daraus die Schlussfolgerungen zieht. b) Bei heteronomer Entscheidung ist zu unterscheiden zwischen einem institutionalisierten und einem personalisierten Verfahren. Im heteronom-institutionellen Fall geht die Entscheidung aus den Daten und dem beigezogenen Bezugsmaterial automatisch hervor, wenn ein im voraus festgelegtes Entscheidungsverfahren durchgespielt wird. Beispielsweise sind Schulnoten Daten; der Schiiler wird nicht promoviert, wenn sein nach Vorschrift gewichteter Durchschnitt nicht 4,0 erreicht. Eine multiple Regressionsgleichung aus mehreren Testprädiktoren auf ein Selektionskriterium bringt ebenfalls heteronom-institutionelle Entscheidungen hervor.
c) Weitaus die meisten Institutionen delegieren jedoch die Aufgabe des Entscheidens an Personen, die angesichts eines Datenmaterials, sei es ad hoc oder objektiv oder gemischt, in einem intuitiven oder quasi-aktuarischen Prozedere die Entscheidung treffen.
Die vier Fragen und ihre 10 Antworten sind natürlich nicht
unabhängig voneinander. Es ergeben sich prinzipiell 36
Paradigmata von Diagnostik; aber etwa die Hälfte davon
sind sinnlos, weil beispielsweise intuitives Vorgehen in
heteronom-institutionellen Entscheiden unmöglich oder
aktuarisches Vorgehen bei ad hoc-Daten unsinnig sind (vgl. Tabelle
1). Dennoch wird gerade Letzteres recht häufig praktiziert, etwa
bei Selektion auf Grund von Schulnoten.
Tab. 1: Übersicht über die 36 Paradigmata der
Diagnostik (vgl. Text)
VD = Validitätsdilemma, MD = Machtdilemma
Kontrakt | Entscheidungsträger | Datensammlung |
|---|
ad hoc | "objektiv" |
|---|
Entscheidungsweise | Entscheidungsweise |
|---|
intuitiv | aktuarisch | intuitiv | aktuarisch |
|---|
frei | autonom | Ideal pers. Ber. | -- | fundierte Beratung | VD |
|---|
heteronom-persönl. | Vertrauens-Verhältnis | -- | VD | VD |
|---|
heteronom-institut. | -- | -- | -- | -- |
|---|
bedingt frei | autonom | Machtgefälle | -- | VD+MD | VD |
|---|
heteronom-persönl. | Machtgefälle | (Selektions-Praxis) | VD+MD | VD |
|---|
heteronom-institut. | -- | -- | -- | VD verschärft |
|---|
aufgezwungen | autonom | -- | -- | -- | -- |
|---|
heteronom-persönl. | Expertenurteile | (z.B. Schulpromotion) | Expertenmacht | Totalitarismus |
|---|
heteronom-institut. | -- | -- | -- | Totalitarismus |
|---|
Einige weitere Fälle möchte ich herausgreifen:
Wenn der Gerichtsgutachten um sein Expertenurteil gebeten wird, so
diagnostiziert er in der Regel in einem aufgezwungenen
Kontrakt auf Grund von ad hoc-Daten in intuitiver
Weise, und er repräsentiert in seiner Person die
entscheidende Institution weitgehend. Hier entsteht ein
ausgesprochenes Machtgefälle zwischen Diagnostiker und Proband,
das im analogen Fall beim bedingt freien und sogar beim
freien Kontrakt nur wenig gemildert ist. Denn der Diagnostiker
kann Willkür üben sowohl beim Datensammeln wie auch beim
Verarbeiten. Der Proband kann wenig mehr tun als sich diesem
"Besserwisser" anvertrauen. Der Diagnostiker rechtfertigt seine
Empfehlungen oder Entscheidungen letztlich aus seiner
persönlichen Autorität, ohne allerdings dafür
persönliche Verantwortung zu übernehmen. Der Proband kann
nie wissen, wie weit die Entscheidungen des Diagnostikers durch
dessen Interessen bestimmt sind. Ausweichen kann er seinen
Empfehlungen nur im freien Kontrakt. Aber auch da muss ihn das
Gefühl des Ausgeliefertseins an einen unkontrollierbaren
Mehrwisser plagen. Eine Einbusse in seinem Selbstwertgefühl ist
in vielen Fällen für den Probanden die Folge: denn befolgt
er den Rat des Diagnostikers, so hat er gewissermassen "aus der Hand
des Experten" gelebt; schlägt er ihn aus und die Entwicklung
gibt dem Diagnostiker recht, so ist erst recht sein
Selbstwertgefühl angeschlagen und seine Unfähigkeit, aus
sich selbst heraus zu leben, demonstriert.
Bei ad hoc-Daten ist eigentlich nur der Fall der
intuitiven und autonomen Entscheidung im freien
Kontrakt vertretbar. Man könnte ihn als Idealfall
persönlicher Beratung darstellen. Etwas problematisch macht ihn
bloss die Möglichkeit von Widersprüchen zwischen der
Datenaufbereitung verschiedener Diagnostiker.
Alle übrigen Fälle bei ad hoc-Daten -- und das
gilt auch bei objektiven Daten, sobald die Entscheidung
intuitiv ist! -- führen grundsätzlich in ein
bedenkliches Dilemma zwischen Zufall und Willkür. Ich
nenne es das Machtdilemma, weil der Proband dem Diagnostiker
ausgeliefert ist und/oder keine Möglichkeit hat herauszufinden,
ob die Entscheidung oder Empfehlung bloss zufällig so
herauskommt oder ob sie der Diagnostiker im Hinblick auf seine
eigenen Interessen und Ziele so steuert. Man muss dabei dem
Diagnostiker durchaus nicht notwendig Manipulation unterstellen; aber
auch der Diagnostiker ist ein Mensch, auch er unterliegt den
Mechanismen der Sozialwahrnehmung und der Dissonanzreduktion;
häufig ist er Angestellter einer interessierten Institution, oft
sogar des Staates. Aus der Sicht des Diagnostikers stellt sich
eigentlich das Machtdilemma sogar verschärft: er ist versucht,
die Datensammlung, die Datenauslese, die Datenverarbeitung genau so
anzulegen, dass die Dinge gerade zueinander und zu seinen
Zielsetzungen passen; er kann leicht sagen und die meisten
Diagnostiker werden das durchaus mit gutem Gewissen tun! -, er handle
im besten Interesse seines Probanden. Aber genau das ist der Kern des
ethischen Problems: was der Diagnostiker ad hoc zusammenstellt
und/oder intuitiv entscheidet ist von niemandem, und insbesondere
nicht vom Probanden selbst, nachprüfbar, weil es bloss aus der
Person dieses Diagnostikers gerechtfertigt ist.
Sie werden nun einwenden, das sei doch schliesslich bei allen
Dienstleistungen von Professionen wie Aerzten, Anwälten,
Architekten usf. genau so der Fall. Die arbeitsteilige Gesellschaft
beruht ja darauf, dass es Leute gibt, die über gewisse Dinge
besser Bescheid wissen als alle andern. Mir scheint, dieser Einwand
übersieht einen fundamentalen Unterschied zwischen
Dienstleistungen bezüglich Einzelfunktionen und solchen, die
gewissermassen die ganze Person betreffen. Es ist sinnvoll,
Einzelentscheide an Experten zu delegieren; in der Regel ist der
Erfolg solcher Entscheidungen hinterher beurteilbar und leider mit
einigen Ausnahmen! sind die professionellen Experten flir
Fehlentscheide haftbar. Nicht so bei typischen psychologischen
Dienstleistungen: betroffen ist in der Regel die gesamte
Persönlichkeitsentwicklung des Probanden; bis ein
allfälliger Schaden erkennbar wird, ist eine Wiedergutmachung
schwer oder unmöglich und jedenfalls sind Lebensabschnitte
"vertan". Eine Uebernahme der Verantwortung durch den Psychologen ist
rhetorisch.
Die Fälle von Diagnostik auf Grund von objektiven
Daten sind In der heutigen Praxis sehr viel seltener. Auf die
Forderung dieser Paradigmata zielen die
Methodenvorbesserungsvorschläge der meisten Testtheoretiker ab.
Sie führen jedoch in ein zweites Dilemma zwischen dem Zufall
und dem Schicksal, das ich das Validitätsdilemma
nennen möchte.
Verfügten wir über psychodiagnostische Verfahren mit
vollständiger Validität, so wäre dies aus dem
Gesichtspunkt des testtheoretisch orientierten Diagnostikers ideal,
für den Probanden jedoch unerträglich, da ihm jede
Wahlfreiheit entzogen wäre. Die diagnostischen Verfahren,
über die wir tatsächlich verfügen, eröffnen
andererseits wieder dem Zufall das Feld. Das ist aus der Sicht des
Diagnostikers, insbesondere bei institutionellen, aber auch
bei persönlich-heteronomen Entscheidungen im Rahmen von
Wahrscheinlichkeitsüberlegungen durchaus sinnvoll. Aus der Sicht
des Probanden stellt sich das Problem anders! Eine Entscheidung, die
im Sinne einer Prädiktion mit der Wahrscheinlichkeit p getroffen
wird, ist für den Probanden nicht zu p% richtig; sondern sie
wird sich einmal als entweder 100% richtig oder 100% falsch
herausstellen. Das Dilemma besteht für alle Prädiktionen,
die mit Validität irgendwo zwischen r = 0 und r = 1 gemacht
werden. Je kleiner die Validität, desto weniger sinnvoll ist es
für den Probanden, die Prädiktion zu berücksichtigen,
obwohl für die entscheidende Institution beispielsweise durchaus
noch ein Selektionsgewinn gegeben sein kann. Je grösser
andererseits die Validität, desto weniger sinnvoll ist es
für den Probanden, die Prädiktion nicht zu
berücksichtigen. Denn eine valide Prädiktion zu
missachten hiesse doch eigentlich das Schicksal herausfordern. Eine
valide Prädiktion zu beachten heisst jedoch wiederum seine
Autonomie aufzugeben, aus dritter Hand zu leben. Das
Validitätsdilemma stellt sich nicht grundsätzlich anders,
ob die Entscheidungsweise nun heteronom oder autonom ist und der
Kontrakt aufgezwungen oder frei.
Versucht man nun, dem Validitätsdilemma auszuweichen, indem
man -- wie dies auch von Pulver (1975) vorgeschlagen wird -- bewusst
die unvollständige Validität des Verfahrens in Kauf nimmt
und die Lücke zur Rechtfertigung der Entscheidung von Seiten des
Diagnostikers durch ein intuitives und also
heteronom-persönliches Verfahren oder durch den Beizug von ad
hoc-Daten überbrückt, so fällt man notwendig wieder
ins Machtdilemma.
Die psychodiagnostische Praxis führt also in manchen
Fällen in ein Dilemma zwischen zwei Dilemmata.
Top of
Page
Die bisherigen Überlegungen gelten für den skizzierten
Schwebezustand der Diagnostik zwischen Wissenschaft und "Kunst"
(MEILI. 1976). Die Frage stellt sich nun, ob und wie eine
psychologische Diagnostik auf dem Hintergrund einer Psychologie
aussehen würde, welche die drei einleitend angeführten
Grundtatsachen des Psychischen berücktigt. Naturgemäss sind
die folgenden Gedanken sehr spekulativ.
Eine interaktionistischeAnwendung von Psychologie
auf das Individuum ist denkbar und wohl prinzipiell machbar.
Voraussetzung dazu ist zunächst eine brauchbare Taxonomie
personaler Merkmale. In dieser Hinsicht lässt allerdings der
jetzige Wissensstand einige Wünsche offen, wie etwa an der
beträchtlichen Variabilität der Ansätze bei
Intelligenz- oder Persönlichkeitskonstrukten und insbesondere an
der weitgehenden Stagnation dieser Forschung seit gut 20 Jahren, zwar
nicht im Umfang, wohl aber im Erkenntnisgewinn, abzulesen ist. Die
zweite Voraussetzung ist eine Systematik der Umwelten. Die Forschung
dazu ist kaum erst begonnen worden. Sie verfügt über
allerlei Schlagworte, die auf der Umwelt-Welle schwimmen, hat aber
bisher kaum ernst zu nehmende Begriffe und Methoden entwickelt
(FREDERIKSEN, 1972; KAMINSKI et al., 1975; ITTELSON et al., 1974;
LANG, 1974). Das Fehlen einer psychologischen Ökologie bzw. die
damit verbundene Willkür in der Auswahl und Definition
sogenannter Reize ist ja wohl ein zentrales Ärgernis in der
modernen Psychologie überhaupt.
Wären diese beiden Voraussetzungen in auch nur einigermassen
befriedigender Weise erfüllt, so könnte man in Kenntnis der
Person-Situation-Interaktion für jeden Bereich von
Realsituationen einen Satz von Modellsituationen schaffen, aus deren
Wirkung auf das Verhalten ausgewählter Versuchspersonen sich
deren Verhalten in jenen Realsituationen vorhersagen liesse.
Vorausgesetzt, die Grundtatsache der Individualität
erlaubte die Formulierung von genügend präzisen
allgemeinpsychologischen Gesetzen, und die Grundtatsache der
Entwicklung stünde der Anwendung solcher Gesetzen nicht
im Wege!
Über diese beiden Probleme angewandter
Differentialpsychologie sind, glaube ich, nur Mutmassungen
möglich; wir haben die Ergebnisse künftiger Forschung
abzuwarten. Wir können skeptisch annehmen, dass aus unserer
bisherigen Kenntnis genetischer Mechanismen genügend Indizien
für das Gegenteil vorliegen, so dass wir es erst gar nicht
versuchen mögen. Ich denke hierbei besonders an die
Unbestimmtheit des Ergebnisses geschlechtlicher Zeugung, welche
Individualität begründet, sowie an die Unbestimmtheit des
Verlaufs von Erfahrungssammlung, welche Individualität ausformt
und in welche wir, analog wie bei der Phylogenese, Ziele bloss
hineinprojizieren können. Oder wir können ebensogut
optimistisch behaupten, diese Indizienbeweise erwüchsen bloss
aus der Begrenztheit gegenwärtigen Wissens; was uns jetzt
zufällig und bloss in der Rückschau sinnreich erscheine,
gehorche schliesslich auch wiederum Gesetzen, die es zu erforschen
gelte.
Da vermutlich allerdings die Aufklärung weiterer Mechanismen
wiederum einen weiteren Rest unaufgeklärten Zufalls eingestehen
muss, könnte es sein, dass hier ein Regress ad infinitum
aufscheint. Die Frage der weiteren Forschung inüsste demnach
ökonomischen Kriterien unterworfen und insbesondere unter dem
Gesichtspunkt der Zielsetzung beurteilt werden.
Damit bestünde zwischen der optimistischen und der
skeptischen Haltung in der Konsequenz bloss ein gradueller
Unterschied, und eine solche utopische Psychodiagtiostik --
echt interaktionistisch und so weit möglich Individualität
und Entwicklung berücksichtigend -- wäre ihrerseits nur
graduell unterschieden von der gegenwärtigen, vorläufigen
Psychodiagnostik. In einer solchen utopischen Psychologie könnte
wohl der Spielraum freier Wahl etwas enger als in der
gegenwärtigen sein; die Entscheidungsalternativen könnten
wohl spezifischer formuliert und schärfer voneinander
unterschieden werden. Aber genau dies müsste das
Validitätsdilemma nur verschärfen; und jeder Versuch des
Diagnostikers, den engen Entscheidungsspielraum für den
Probanden gewissermassen zu humanisieren, müsste umso
stärker das Machtdilernma akzentuieren.
Schlussbemerkung
Ich bin kein Kulturphilosoph. Aber ich kann nicht umhin, die Frage
der Autonomie der Person als die mutmassliche zentrale Frage unserer
Zeit zu betrachten. Dafür zeugen nicht nur die Entwicklung in
der Frage der Partizipation oder die weltweiten Autarkiebestrebungen
oder Anarchismus und Drogensucht (wenn ich nicht befriedigend autonom
leben kann, kann ich ebensogut mein Leben wegwerfen), sondern ganz
besonders auch eine fundamentale Gegensätzlichkeit zwischen der
sozialistischen und der im Westen vorherrschenden Weltanschauung:
nämlich ob letzten Endes das Individuum für die
Gemeinschaft oder die Gemeinschaft für das Individuum da sein
soll.
Meine persönliche Wertung ist eindeutig für eine starke
Autonomie der Person. Ich weiss, dass ich nicht ohne Gemeinschaft
leben kann; immerhin kann ich es in einer reduzierten Gemeinschaft.
Eine umfassende und mehr oder weniger durchorganisierte Gemeinschaft,
der ich in keiner Weise ausweichen kann, macht mir aber Angst, legt
mir soviel Sachzwang und/oder durch andere Personen verkörperte
Macht auf, dass mir wenig Spass am Leben bleibt. Mancher versucht,
wenn er der Macht nicht ausweichen kann, nach Möglichkeit selber
über solche Macht zu verfügen. Setzt er sich über den
Machtanspruch des Andern hinweg, so wird sich erweisen, welcher
Anspruch stärker ist. Ich zweifle, dass auf diesem Weg eine
lebenswerte Gemeinschaft möglich ist.
Meine Alternative: ich werte die Autonomie der Person hoch und
sehe ihre Begrenzung im Autonomieanspruch des Andern, den ich achten
muss, wenn ich meinen eigenen Autonomieanspruch erfüllt haben
will. Jede Einschränkung der Autonomie in einem angeblich
überindividuellen Interesse bedarf der Rechtfertigung durch
einen interindividuellen Konsens.
Auf die Diagnostik bezogen heisst das, dass ich all jene
Paradigmata, wo entweder der Kontrakt oder die Entscheidung autonom
erfolgen, für verhältnismässig unproblematisch halte;
es bleibt allenfalls abzuklären, inwieweit solche diagnostischen
Praktiken ihren Aufwand wert sind. Bei allen andern Paradigmata
jedoch, d.h. sobald der Kontrakt eingeschränkt oder gar
unausweichlich ist oder die Entscheidungsträger andere Personen
sind, ergibt sich ein unlösbares doppeltes Dilemma:
Entweder erfolgt die Datensammlung objektiv und die
Entscheidung aktuarisch: dann bin ich entweder meinem Schicksal (im
Falle vollständiger Validität des Verfahrens) oder dem
Zufall (im Falle unvollständiger Validität) ausgeliefert;
oder die Entscheidungsgrundlage, also die Daten, oder die
Entscheidung selbst, sind bloss durch Personen gerechtfertigt: dann
bin ich wieder entweder dem Zufall oder dem Machtanspruch des
Diagnostikers bzw. dessen der hinter ihm steht ausgeliefert.
Entweder dem Machtdilemma oder dem Validitätsdilemma ist
nicht auszuweichen. Allemal sind das Welten -- Schicksal, Zufall oder
Willkür --, die ich nicht für anstrebenswert halte.
Insofern die diagnostische Praxis dazu beiträgt, solche Welten
zu fördern, möchte ich dafür plädieren, dass man
Diagnostik nicht als ein hauptsächliches Anwendungsgebiet der
Psychologie pflegt.
Top of
Page
Literatur
BOWER, S.: Situationism in Psychology: an analysis and a critique.
Psychol. Review 80, 307- 36, 1973.
FREDERIKSEN, N.: Toward a taxonomy of situations. American
Psychologist 27, 114-123, 1972.
ITTELSON, W. H., PROSHANSKY, H.M., RIVLIN, L.G., WINKEL, G.H.: An
introduction to environmental psychology. Holt-Rinehart-Winston, New
York 1974.
KAMINSKi, G.: Verhaltenstheorie und Verhaltensmodifikation. Klett,
Stuttgart 1970.
-- Umweltpsychologie: Bericht über ein Symposion. Bericht
über den 29.Kongress der Deutschen Gesellschaft für
Psychologie in Salzburg 1974. Hogrefe, Göttingen, 1975, 2(5 --
280.
LANG, A.: Über zwei Tellsysteme der Persönlichkeit:
Beitrag zur psychologischen Theorie und Diagnostik. Huber,
Bern/Stuttgart/Wien 1964.
-- Versuch einer Systematik der Umweltpsychologie. Manuskript,
Psychol. Inst. Univ. Bern, 1974.
LEWIN, K.: Der Übergang von der aristotelischen zur
galileischen Denkweise in Biologie und Psychologie. Erkenntnis 1,
421-460, 1931; Neudruck: Wissensch. Buchgesellschaft, Darmstadt,
1971.
-- Feldtheorie in den Sozialwissenschaften: ausgewählte
theoretische Schriften. Huber, Bern/Stuttgart/Wien 1963.
MEILI, R.: Bemerkungen zur sog. Krise der psychologischen
Diagnostik. Schweiz. Zeitschr. Psychol. 35, 59-61, 1976.
PULVER, U.: Die Krise der psychologischen Diagnostik -- eine
Koartationskrise. Schweiz. Zeitschr.Psychol. 34, 212-221, 1975.
SPÖRLI, S.: Erste Validierung der schweizerischen
verkehrspsychologischen Normaluntersuchung. Schweiz.Zeitschr.Psychol.
32, 91-121, 1973.
TRIEBE, J. K.: Eignung und Ausbildung: Vorüberlegungen zu
einem eignungsdiagnostischen Konzept. Schweiz. Zeitschr.Psychol. 34,
50-67, 1975.
Top of
Page