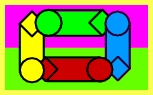Alfred Lang | University of Bern, Switzerland | 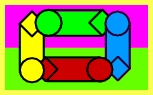 |
Journal Article 1982 |
Besser wohnen -- anders bauen | 1982.02 |
@DwellPrax |
49 / 58KB Last revised 98.11.04 |
Schweizerische Zeitschrift für Gemeinnützigkeit 121 (4) 85-97 Vortrag an der Tagung vom 8.12.1981 über «Familie - Wohnen - Zuhause» im Kongress- und Kursaal in Bern, veranstaltet von der Kantonalen Kommission für Gemeinnützigkeit, in Zusammenarbeit mit der Ökonomischen und Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons Bern | © 1998 by Alfred Lang |
info@langpapers.org |
Scientific and educational use permitted |
Home || |
Meine sehr verehrten Damen und Herren!
Vielleicht hat es Sie überrascht, dass ein Psychologe zu
Ihnen über Bauen und Wohnen sprechen soll, und erst noch
über «besser wohnen und anders bauen». Da gibt es doch
die Architekten und Designer, die zuständig sind. Und zwar
für «schöner wohnen» und für «richtig
bauen». Was soll da die Psychologie, die sich doch mit der
Harmonie des Innenlebens befasst - nicht in den Wohnungen, sondern in
Geist und Seele? Ich muss Ihnen also einleitend erklären, warum
gerade die Psychologie hier etwas zu sagen hat. Ich möchte das
Verhältnis der Psychologen oder allgemein der
Sozialwissenschaftler zu den andern beim Bauen und Wohnen Beteiligten
ein Stück weit zu klären versuchen.
Anschliessend werde ich anhand einer Reihe von beispielhaften
Einsichten in das Zusammenspiel von Menschen und ihrem Zuhause
zeigen, dass die Psychologie hier wirklich etwas bringt. Dies obwohl
ich betonen muss, dass die Psychologie nicht nur eine junge
Wissenschaft ist, sondern erst vor kurzem begonnen hat, sich mit
Fragen des Wohnens zu befassen.
Schliesslich möchte ich dann die vorgebrachten Beispiele
etwas verallgemeinern und einige Grundsätze formulieren, die das
Wichtigste zusammenfassen, was man heute aus der Sicht der
Sozialwissenschaften und insbesondere der Psychologie zum Thema
«Familie - Wohnen -Zuhause» sagen kann.
*Zunächst also einige Bemerkungen zum Verhältnis zwischen
Architektur und Psychologie. Lassen Sie mich dazu einen kleinen Umweg
gehen.
Viele von Ihnen sind wahrscheinlich interessierte Beobachter von
Tieren im zoologischen Garten oder im Tierpark. Der Zoodirektor mit
seinen Fachleuten baut den Tieren ein Zuhause mit den nötigen
Gehegen, Schutzhütten, Höhlen, Fressplätzen,
Ausläufen usw. Er ist grob vergleichbar mit dem gesamten
Bauwesen in der menschlichen Gesellschaft, welches für die
Menschen die gebaute, gestaltete Umwelt als eine wesentliche
Lebensbedingung herstellt.
Man kann wohl sagen, dass Zoodirektoren nach ihrem besten Wissen
und Können versuchen, den ihnen anvertrauten Tieren
möglichst optimale Lebensbedingungen bereitzustellen, in denen
sie sich wohl fühlen und in denen sie bestens gedeihen. Dasselbe
mag grundsätzlich auch für die Leute vom Bauwesen gelten:
die Planer und Architekten, die Unternehmer und Handwerker, die
Mitglieder der Baubehörden und Hypotheken-Bankiers, die
Möbel«berater» und Liegenschafts-Verwalter, die
Hauswarte, die Verbandsfunktionäre und die Politiker, die sich
mit Entscheidungen über sogenannte Infrastrukturfragen befassen,
von der Verkehrspolitik über die Raumplanung bis zur
Wohnbaupolitik. Ich Weiss natürlich, dass der Vergleich mit dem
Tierpark hinkt; Tiere und bio-ökologische Systeme weisen zwar
fundamentale Gemeinsamkeiten mit der menschlichen Art und ihrer
Gesellschaft auf, aber eben auch ganz wesentliche Unterschiede. Und
ich Weiss auch, dass der Idealismus und der gute Wille dieser
«Wohnbaufachleute», wie ich sie im folgenden in ihrer
Gesamtheit nennen möch-te, im konkreten Fall eine mehr oder
weniger einseitige Mischung mit mehr oder weniger hartem Eigennutz
eingeht. Und wie anderswo spielen auch hier sogenannte
Sachzwänge mit.
Es gibt nun aber neben andern Ähnlichkeiten und
Verschiedenheiten einen wichtigen Unterschied zwischen den
Tätigkeiten des Zoodirektors und der Baufachleute, auf den ich
mich konzentrieren möchte. Der Zoodirektor hat ein
untrügliches Kriterium zur Verfügung für die
Beurteilung des Erfolgs seines Bauens; die Wohnbaufachleute haben
dies nicht, sie haben - etwas hart ausgedrückt -
überwiegend nur Pseudokriterien, die ihnen glauben machen, dass
sie gute Infrastrukturen für das menschliche Zusammenleben
hergestellt haben. Ich beeile mich, Verständnis dafür zu
bekunden, dass sich die Wohnbaufachleute an Pseudokriterien halten;
dennoch wäre es klug, den Pseudocharakter der meisten Urteile
über Bauten zu erkennen und nach besseren Kriterien zu suchen.
Wenn nämlich der Zoodirektor falsch baut, dann gehen die meisten
Tiere sehr bald ein; die Individuen kränkeln, es kommt kein
Nachwuchs, die Art kann nicht in Gefangenschaft gehalten werden oder
allenfalls unter ständigem Beizug von extremen Mitteln wie
Antibiotika oder anderen Drogen. Sie können hier meinen
hinkenden Vergleich selber weiterdenken bis zur sogenannten
Käfighaltung von Tier und Mensch; ich will mich lieber auf das
Verhältnis zwischen baulichen Strukturen und Leben und
Zusammenleben beim Menschen, auf das Wohnen in einer gebauten,
gestalteten, gemachten Umwelt konzentrieren.
Die Wohnbaufachleute, habe ich gesagt, verf:gen über keine
echten oder harten Kriterien zur Bewertung dessen, was sie planen und
bauen. Der Mensch ist enorm anpassungsfähig, und er passt sich
mit grösster Behendigkeit an die unglaublichsten
Lebensbedingungen an. Dies ist ein wichtiger Unterschied zu den
meisten Tierarten, die ein Anpassung allenfalls im Laufe von vielen
Generationen schaffen; dabei stirbt nicht selten eine Art eigentlich
aus oder wird durch andere abgelöst. Beim Menschen treten
Symptome, die problematisches Bauen anzeigen würden, nicht klar
genug zutage. Wohl sind viele Leute mit ihrer Umgebung unzufrieden,
linden sie hässlich, unpraktisch, unmenschlich; sie leben aber
dennoch «fröhlich weitem und vermehren sich auch. All die
Bresten und Konflikte, mit denen wir leben, könnten auch andere
Ursachen haben; selbstverständlich haben sie auch andere
Ursachen. Harte Symptome treten wohl erst dann auf, wenn es
vielleicht schon zu spät ist. Ich glaube aber, dass viele
Menschen heute das dumpfe Gefühl haben, dass unser Wohnbauwesen
auf Abwege geraten ist. Aber was können wir tun? Gibt es denn
richtiges Wohnungsbauen? Und wie können wir es, wenn es das
gibt, von schädlichem Wohnungsbauen unterscheiden?
Hier tritt nun der Sozialwissenschaftler auf den Plan. Ich
möchte nur in groben Zügen skizzieren, wie ich mir seine
Rolle vorstelle, sein Verhältnis zu den übrigen
Wohnbaufachleuten und insbesondere sein Verhältnis zu
denjenigen, für die alles gemacht wird, nämlich den
Bewohnern. Im wesentlichen ist der Sozialwissenschaftler, wenn er
sein Wissen und Können in den Dienst besseren Wohnens stellen
will, so etwas wie ein «Mikroskop» und eine
«Zeitraffmaschine», welche langfristige oder subtile oder
versteckte Zusammenhänge sichtbar machen können. Der
Zoodirektor sieht spätestens nach wenigen Generationen, im
ungünstigen Fall sogar innerhalb einer Generation, ob seine
Tiere gedeihen oder nicht. Beim Menschen finden wir eine Baukultur,
d. h. ein sozial bestimmtes Bauverhalten, das im Unterschied zu dem
eher fixierten biologischen Tier-Umwelt-Verhältnis sehr flexibel
und variabel ist. Über Jahrhunderte und Jahrtausende war das
Bauen von Behausungen in hohem Masse durch Überlieferung
bestimmt und jeweils in einer Gegend nur wenig variabel. In einem
allmählichen Wandel wurden stets die Erfahrungen von Hunderten
von Generationen von Vorfahren verwertet. Seit der industriellen
Revolution, seit etwa 200 Jahren, beobachten wir eine Explosion der
Veränderung von Baumaterialien, Bauweisen und Bauformen. Die
Entwicklung geht zu rasch, als dass wir die Erfahrungen, die sich mit
den neuen Formen ergeben, schnell genug auswerten könnten. Wir
müssen also unsere veränderte Baukultur ergänzen durch
ein weiteres kulturelles Element, das imstande ist, jenen langsamen
und impliziten Auswertungsvorgang in einem wesentlich rascheren Tempo
und explizit oder bewusst durchzuführen. So wie unsere Kultur
sich entwickelt hat, wird man dafür die Wissenschaften
beiziehen.
Die Definition der Rolle des Sozialwissenschaftlers im Wohnwesen
ist eine extrem heikle. Ich kann sie hier nur streifen. Aber ich
möchte deutlich machen, dass man nicht vom Sozialwissenschaftler
erwarten darf, dass er sagt, was richtiger oder guter und was
falscher oder problematischer Wohnungsbau ist. Ich habe vorhin von
Pseudokriterien gesprochen, die der Wohnbaufachmann zur Beurteilung
seiner Produkte benutzt. Auch das Urteil des Sozialwissenschaftlers
wäre ein Pseudokriterium, selbst dann, wenn er es auf die
Resultate von Bewohnerumfragen abstützt. In der Tat ergeben
Befragungen von Bewohnern durchwegs sogenannt «gute
Ergebnisse». Egal in was für Quartieren man fragt, sagen im
Durchschnitt etwa 80% der Bewohner (mal sind es 70, mal 90) dass sie
mit ihrer Wohnung und mit ihrem Quartier zufrieden seien.
Natürlich macht man sich mit solchen Befragungen etwas vor, wenn
man aus den Zahlen schliesst, es sei alles weitgehend in Ordnung.
Verwunderlich wäre nämlich, wenn die Resultate anders
ausfielen. Die Mehrzahl der Befragten verfügt ja nicht über
wirkliche Vergleichsmöglichkeiten; und wer ist schon bereit zu
sagen, seine eigene Wahl sei verfehlt gewesen, auch wenn sie nicht
eine völlig freie Wahl gewesen ist. Befragungsbewertungen sind
aus methodischer Notwendigkeit so wie sie sind; sie beschreiben nicht
wirklich die Verhältnisse.
Der Sozialwissenschaftler, wie ich ihn vor allem sehe, macht etwas
anderes. Der Sozialwissenschaftler hofft, den Rückmeldekreis von
der Bauweise über die Bewohner zurück zur besseren Bauweise
kürzer schliessen zu können, ein Rückmeldekreis, der
in statischeren Kulturen mit Bautraditionen über Jahrhunderte
sich erstreckte. Der Sozialwissenschaftler kann deutlich machen, dass
am Bauen mehr als das Gebäude ist. Der Sozialwissenschaftler
lenkt den Blick auf ein grösseres Ganzes, von dem die Wohnung
nur ein kleiner Teil ist. (Ungefahr das Gegenteil trifft zu von dem,
was ich kürzlich einen Wohnbaufachmann von einigem Einfluss
sagen hörte: für ihn, den Wohnungswesenfachmann sei die
Familie nur ein ganz kleiner Teil seines Arbeitsbereichs.) Dieses
grössere Ganze ist im Titel dieser Tagung angesprochen: da ist
nicht von der Wohnung die Rede, vom Objekt des Wohnbaufachmanns,
sondern vom Wohnen und von der Familie und vom «Zuhause».
Dazu gehören auch noch die Gemeinschaft, die Nachbarschaft und
die individuellen Menschen. Dazu gehört auch, was die Menschen
tun, wenn sie wohnen; wenn sie allein wohnen, wenn sie zusammen
wohnen; wenn sie als Kinder wohnen oder als Erwachsene oder als
Betagte; wenn sie am Morgen wohnen oder am Abend oder am Sonntag. Der
typische Wohnbaufachmann sieht und denkt zu kurz. Er ist -
begreiflicherweise - fasziniert vom Objekt seines Tuns. Er denkt in
Kategorien der Ökonomie, der Ästhetik und der Funktionen,
die in dem Gebäude erfüllt werden müssen. Da braucht
man dann so viele Quadratmeter für ein Schlafzimmer, so viele
für ein Wohnzimmer, ein Kinderzimmer; eine Küche, in der
die üblichen Apparate schön in Linie aufgestellt werden
können; ebenso Sanitäreinrichtungen, und die müssen
nicht nur gut funktionieren, sondern auch das Auge erfreuen usw.,
usw. Wie überhaupt das ganze Gebilde den günstigsten
Kompromiss zwischen Schönsein, Praktischsein und Billigsein
verwirklichen muss. Und wenn dieses Gebilde dann noch recht in die
Gegend passt, d. h. weder durch Ungewöhnlichkeit noch durch
Gewöhnlichkeit auffallt, dann ist der erste Preis gewonnen. Es
ist interessant, dass wir in der Schweiz wie in andern Ländern
über eine ausgedehnte Praxis und Gesetzgebung über den
Wohnungsbau verfugen, gestützt durch über eine zwar
quantitativ bescheidene, aber qualitativ doch recht ansehnliche
Wohnbauforschung. Aber wir haben praktisch keine Forschung und auch
kaum sicheres Wissen über das Wohnen als eine menschliche
Tätigkeit ersten Ranges. Rund ein Drittel ihres Lebens
verbringen die meisten Menschen in der Tätigkeit des Wohnens,
das Schlafen nicht mitgerechnet.
Denn dieses Objekt, die Wohnung oder das Wohngebäude, oder
auch das Wohnquartier, ist ja nicht Selbstzweck. Sondern es ist nur
ein Bestandteil in einem äusserst komplexen gesellschaftlichen
und kulturellen Geschehen. In Wohnungen und um Wohnungen herum findet
nicht nur nach seinem Zeitanteil der grösste Teil unseres Lebens
statt: hier geschehen auch so wichtige Dinge wie vermutlich der
grösste Teil unserer Erziehung (Sozialisation); der grösste
Teil unseres Zusammenlebens mit den andern, die Zuneigung wie die
Auseinandersetzung; der grösste Teil dessen, womit jeder von uns
sich selbst zu dem macht, was er ist oder gerne sein möchte; der
grösste Teil unserer menschlichen Kultur lindet weitgehend
versteckt im Wohnen statt, der sichtbare Teil, die
«offizielle» Kultur, ist nur die Spitze eines Eisbergs.
Der Sozialwissenschaftler, im besonderen der Wohnpsychologe, kann
heute - erst sehr rudimentär - aufzeigen, wie dieses Geschehen
funktioniert.
Ichskizziere hier in Grundzügen eine Auffassung vom Wohnen,
die weiter ist als die allgemein verbreitete. Häufig meint man,
wenn man vom Wohnen spricht, nur das gemeinsame Sitzen im Wohnzimmer.
Das ist zu eng; für das Alltägliche, das
Selbstverständliche haben wir oft keine Worte. In der englischen
Sprache ist «Wohnen» gleichbedeutend mit «Leben»:
to live. Ich verstehe Wohnen als eine Tätigkeit. Sie ist von
zentraler Bedeutung für die menschliche Existenz. Es ist nicht
uninteressant, dass in den indogermanischen Sprachen
«wohnen» und «bauen» gemeinsame Wurzeln haben;
«bauen» ist transitiv, «wohnen» intransitiv.
Bauen ist Wohnen-Machen. In meinem Verständnis ist Bauen ein
Versuch der Menschen, die andern Menschen und sich selbst zu
beeinflussen. Beeinflussen, sich so oder so zu verhalten;
beeinflussen, sich so oder anders zu entwickeln; beeinflussen, dieser
oder jener Mensch zu werden. In bestimmter Weise bauen, heisst, in
bestimmter Weise beeinflussen. Wir bauen immer in bestimmter Weise;
das heisst, wir beeinflussen unser Leben immer in bestimmter Weise.
Den Zusammenhang zwischen Bauen und Lebenbeeinflussen zu verstehen,
ist die Aufgabe des Wohnpsychologen.
Wenn wir dieses Geschehen verstehen, dann können wir besser
wohnen, und dann werden wir, das ist meine Behauptung, anders bauen.
Aus solchem Verständnis Konsequenzen ziehen, sollten aber alle
Beteiligten, nicht nur die Wohnbaufachleute, sondern ebensosehr alle
Leute, welche wohnen; und wer ist das nicht? Soweit meine etwas lang
geratene Einleitung. Im folgenden Teil meines Referats möchte
ich nun an einigen ausgewählten Beispielen zu zeigen
versuchen, wie das Bauen das Wohnen «macht» und wie das
Wohnen Menschen «macht». Ich betone, dass wir weit
entfernt sind von einem umfassenden Verständnis des Wohnens. Ich
lasse bewusst offen, ob Sie das so oder so Bauen als gut oder als
schlecht beurteilen wollen; in den meisten Fällen werden wir uns
mehr oder weniger einig sein. Aber ich gehe davon aus, dass es die
Würde des Menschen ausmacht, innerhalb eines Rahmens von
Gesellschaft selber darüber zu entscheiden, wer er sein will;
damit müsste er auch innerhalb dieses Rahmens von Gesellschaft
darüber entscheiden können, wie er wohnen will. Das
Verstehen der Wirkungszusammenhänge zwischen Bauen, Wohnen und
Leben ist für solche Entscheidungen eine wesentliche
Voraussetzung.
*Wohnhochhaus
Mein erstes Beispiel betrifft das Wohnen in Hochhäusern oder
grossen Scheibenhäusern. Aus verschiedenen Untersuchungen geht
hervor, dass Kinder in solchen Wohnumgebungen anders aufwachsen als
in kleineren Blöcken oder Einfamilienhausquartieren. Der
Unterschied betrifft insbesondere die Vorschulzeit. Bis zu einem
gewissen Alter (das variiert von 4 bis 7 Jahren) sind die Kinder
stärker ans Heim gebunden; nachher sind sie eher
unabhängiger, vielleicht auch selbständiger.
Man kann das so verstehen, dass das grosse Haus durch seine
Liftanlage, durch sein grosses Treppenhaus, wegen zu vieler fremder
Leute aufs mal eine Art schwer übersteigbare Wand aufrichtet
zwischen dem Innenbereich der Wohnung und der äusseren Welt der
Wohnumgebung, zwischen der Konzentration auf die Mutter und die
Familie im Innenbereich und dem Zugang zu weiteren Erfahrungen,
insbesondere anderen Menschen, Nachbarn und Nachbarkindern im
Umgebungsbereich. Das Kind kann nicht so gut allmählich vom
sicheren Hort der Familie aus auf Erforschung, auf geistige
«Eroberung» der Welt ausgehen. Viele Untersuchungen zeigen,
welche bedeutende Rolle die Mutter für das kleine Kind beim
Explorieren der Welt spielt; immer wieder geht es von der Mutter weg
auf «Entdeckungsreise» und ist doch auf sie angewiesen: es
muss in ihren sicheren Schutz zurückkehren können, wenn die
Angst vor Neuem zu gross wird. Im grossen Haus muss die Mutter das
Kind lange Zeit stets begleiten und es dann vielleicht zu
plötzlich viel zu sehr sich selbst überlassen. Die Mutter
steht ständig im Dilemma, entweder das Kind zu Übermuttern
oder es einer nicht mehr kontrollierbaren Welt, z. B. einer grossen
Spielgruppe, zu überlassen.
Durch diese bestimmte Bauform greifen wir also massiv in die
Entwicklung der Beziehung zwischen Mutter und Kind, zwischen Familie
und Kind einerseits, wie auch anderseits in den Aufbau der Beziehung
des Kindes zu seiner weiteren Umwelt, besonders zu seinen
Spielkameraden, ein. Noch gibt es nur wenig Untersuchungen über
diese «Aneignung der Welt» durch die heranwachsenden
Kinder. Man kann aber bereits deutlich sehen, welche Bedeutung
sogenannte Pufferzonen zwischen innen und aussen haben. Und
vermutlich spielt auch die «Veränderbarkeit dieser
Umwelt» eine wichtige Rolle.
Pufferzone zwischen Wohnung und
Öffentlichkeit
Das grosse Hochhaus ist nur ein verhältnismässig
extremer Fall, wegen seiner Grösse, wegen der Bedeutung des
Lifts. Auch schon bei kleineren Wohnblöcken, wie sie den
städtischen Wohnungsbau der letzten Jahrzehnte kennzeichnen, ist
der Übergang vom Innenbereich der Wohnung in den
öffentlichen Bereich der Wohnumgebung sehr schroff. Ich war
beeindruckt von einer Untersuchung, in der das Spiel von Kindern in
einer Siedlung von Reiheneinfamilienhäusern mit einer hohen
Bevölkerungsdichte beobachtet wurde. Und zwar einmal vor, einmal
nach Anbringen von kleinen Vorgärten mit Bepflanzungen und
niedrigen Zäunen vor den einzelnen Einheiten. Es war ein
deutlicher Unterschied in der Häufigkeit und besonders im
Verlauf von Streitigkeiten zwischen den Kindern festzustellen. Auch
nach dem Einrichten der Vorgärten gab es Streit, aber
beispielsweise war zu beobachten, wie die unterliegenden Kinder
fliehen konnten bis hinter das Tor des eigenen Vorgartens. Dort
liessen die Verfolger von ihnen ab; sie respektierten einen
Schutzbereich. Das unterlegene Kind musste meistens nicht bis ins
Haus flüchten; es blieb beobachtender Teilnehmer am Spiel,
konnte sich beruhigen und früher oder später wieder
hinauswagen. Die Bewältigung des akuten Konflikts, wie wohl auch
der Erwerb von Kompetenz im Umgang mit dem andern wurde durch die
Vorgärten, durch die strukturierte Pufferzone zwischen privat
und öffentlich, unterstützt.
Es ist offensichtlich, dass nicht nur Hochhausanlagen, sondern
auch die meisten Wohnblocküberbauungen arm sind an Zwischenzonen
zwischen dem privaten und dem öffentlichen Bereich. Die
Wohnungstür ist eine schroffe Grenze zu einem Bereich, der
bereits öffentlich zugänglich ist, zumindest in
Häusern mit mehr als ein paar Wohnungen. Man muss im Eingang und
im Treppenhaus darauf gefasst sein, Menschen zu begegnen, die man
überhaupt nicht kennt und auf die man keinen Einfluss
ausüben kann. Vorplätze und Grünflächen zwischen
Wohnblöcken werden nach Kriterien der Schönheit und
Pfleglichkeit gestaltet; und schön heisst hier: was dem
Architekten gefällt, und pfleglich heisst: was dem Hauswart
möglichst wenig Arbeit macht. Man könnte sie auch gestalten
im Hinblick auf die Unterstützung der sozialen Interaktion der
Bewohner durch räumliche Strukturen.
Das Vorhandensein eines strukturierten Zwischen- oder Pufferraums
zwischen dem Privatbereich der Familie und der öffentlichen Zone
von jedermann hat deutlich das Spielverhalten der Kinder beeinflusst.
Und es ist zu erwarten, dass es sich nicht bloss um einmalige
Ereignisse handelt, sondern dass solche Erfahrungen in vielfaltiger
Wiederholung Spuren hinterlassen und einen Menschen in seinem
sozialen Verhalten und seinen Beziehungen prägen. Und es
betrifft durchaus nicht nur die Kinder: haben Sie schon beobachtet,
wie die offenen, ästhetisch mit pflegeleichten Büschen
gestalteten Grünflächen auf der Gartenseite gewisser
Reihenhaussiedlungen leerstehen; während in Siedlungen mit
Zäunen oder Hecken die Nachbarn von beiden Seiten an die Grenze
treten und stundenlang miteinander tratschen?
Veränderbarkeit der Umwelt
Wir haben uns in den vergangenen Jahrzehnten daran gewöhnt,
unsere Umwelt total zu gestalten. Das ist so in städtischen und
vorstädtischen Bereichen und mehr und mehr sogar in
Dörfern. Kein Quadratmeter, der nicht entweder durch Haus oder
Garten, durch Asphalt oder Rabatte, durch Beton und Beschilderung in
seiner Funktion festgelegt ist. Es stört uns, wenn irgendwo ein
Stück Boden längere Zeit ungenutzt bleibt, was bei der
Knappheit des Bodens begreiflich ist; es stört uns aber auch,
wenn irgendwo z. B. einige Dinge herumliegen, mit denen man etwas
machen könnte, oder ein Loch im Boden, an dem man weiter graben
könnte. Warum eigentlich? Einwände wie gestörte
Ordnung oder erhöhte Unfallgefahr kommen mir eigentlich als
Vorwände vor, nicht wichtig genug im Vergleich zu dem, was wir
damit unseren Kindern antun. Wir erschweren ihnen nämlich
dadurch ganz massiv die geistige Aneignung der Umwelt und das
Auf-die-Probe-stellen-Können ihrer Phantasie und ihres Geschicks
im Umgang mit vielerlei Dingen. Nur was man verändern kann,
versteht man wirklich. Statt dessen setzen wir ihnen eine
vorgefertigte Welt aus Beton, Blech und Plastik vor. Spielzeug ist
nicht mehr, was man in der Welt vorfindet, sondern, was von
Erwachsenen eigens für bestimmte Spiele produziert und vom
Spielenden konsumiert werden muss. Spielplätze sind auch
vorgefertigt; und wenn irgendwo einmal die Schaffung eines sog.
Robinsonspielplatzes gelingt, dann wird er ganz sicher mit einer
hohen Bretterwand von unserer sonst so ordentlichen Welt
abgezäunt. Kein Wunder, wenn einige Junge protestieren.
Ich muss zugeben, dass ich bei diesem Thema ein bisschen
spekuliere und mehr über Hypothesen als über Wissen
berichte. Es ist eben leichter, die gesundheitsschädigende
Wirkung von knapper Besonnung nachzuweisen, als die Wirkung einer
vorgefertigten und verarmten Umwelt auf die geistige Entwicklung zu
beweisen. Immerhin gibt es einige Untersuchungen über die
Tätigkeiten von Kindern verschiedenen Alters in verschiedenen
Wohnumgebungen, die solche Vermutungen unterstützen.
Raumprogramm der Wohnungen
Nun ein paar Einblicke in die Tätigkeit des Wohnens innerhalb
der Wohneinheiten Sie kennen alle das Programm der modernen
Architektur für die industrialisierte Gesellschaft. Die meisten
von ihnen dürften es täglich am eigenen Leib erfahren. Es
geht aus von der Funktionenteilung: der Mensch arbeitet und
regeneriert sich für weitere Arbeit. Die beiden Funktionen
werden räumlich getrennt: Arbeit am Arbeitsort; Erholung in der
Wohnung mit gelegentlichen Seitensprüngen in die dafür
vorgeplante kultivierte Natur; durch den Ortswechsel von der
Arbeitswelt zur Freizeitwelt entsteht eine dritte Funktion, der
Verkehr. Der moderne Städtebau beruht auf dieser
Funktionenteilung. Und die Funktionenteilung wird fortgesetzt
innerhalb der Wohnung. Corbusier hat dafür den Ausdruck
«Wohnmaschine» geprägt. Da die Erholung aus Schlafen,
Essen, Vorbereiten des Essens, Körperpflege und Zusammensitzen
besteht, bietet die ideale Wohnmaschine für jede Funktion genau
einen Raum an, vorgefertigt für genau diese Funktion. Dazu
kommen sogenannte Kinderzimmer, weil es auch eine Funktion der
Familie ist, für den Fortbestand der Menschheit zu sorgen.
Für alle andern Funktionen des Menschen sind Orte ausserhalb der
Wohnung vorgeplant: die Kinderspielplätze,die
Einkaufsläden, die Begegnungsorte, die Sporthallen usf.
Es fallt mir schwer, diese Dinge anders als zynisch zu
formulieren. Was ich beschreibe, ist aber durchaus nicht Karikatur,
sondern war das Programm der Sozial-Ingenieure; und es ist auch heute
noch das Ideal mancher Planer, zugegeben nicht mehr aller. Und es war
insbesondere das Programm für die Förderung der sozialen
Wohlfahrt. Was ich geschildert habe, umgesetzt in Quadratmeter und
Minimalausstattung, sind die Normen des sozialen Wohnungsbaus. Diese
haben unter dem bekannten Kostendruck darüber hinaus weite Teile
des Wohnungsbaus bestimmt. Ein zweifellos höchst erfolgreiches
Programm; denn es ist damit gelungen, etwa in weiten Teilen
Mitteleuropas und Nordamerikas praktisch der gesamten
Bevölkerung wenigstens in materieller Hinsicht
menschenwürdige Wohnbedingungen zu verschaffen. Bei voller
Anerkennung dieser Tatsache bleibt dennoch ein Rest von Zweifel: Das
Programm impliziert ein - sagen wir einmal - sehr reduziertes
Menschenbild. Man könnte auch die These aufstellen, dass ein
solches Programm des kasernierten Wohnens einen leicht lenkbaren,
abhängigen Menschen erzeugt. in jeder Hinsicht ideal für
die Produktions- und Konsumgesellschaft, in der wir leben. Dem
Programm liegt ein Menschenbild zugrunde, das - oft im Gegensatz zu
seiner Propaganda - nicht die Würde der Person als Individuum
und in der Gemeinschall als zentralen Wert und Lebenssinn anerkennt.
Es liegt mir fern, hier - jedenfalls für unser Land - irgendeine
Art Verschwöreroder Drahtziehertheorie aufzustellen. Ich
möchte nur die Frage aufwerfen, ob wir in dieser Hinsicht die
Werte sinnvoll gesetzt haben. Und ich möchte das Setzen der
Werte zurückverfolgen bis in die konkreten Einzelheiten des
Wohnbereichs.
Ich knüpfe an das vorher über die Perfektion in der
Vorausplanung des Aussenraums Gesagte an. Auch das Innere der
Wohnungen wird von den Fachleuten vorausgedacht und fertiggemacht.
Gestatten Sie mir, das in Form eines Merksatzes zu formulieren: die
fertiggemachten Wohnungen machen die darin lebenden Familien fertig.
Ich will das mit einigen Beispielen aus sozialwissenschaftlichen
Untersuchungen und daran anknüpfenden Überlegungen
verdeutlichen.
Das Raumprogramm der typischen Blockwohnung legt, entsprechend dem
Programm der Wohnmaschine, die Familie und ihre Mitglieder auf die
vorgeplanten Funktionen oder Tätigkeiten fest. Will man diesem
Plan entgehen, will man sich darüber hinaus entwickeln, so muss
man gegen die oft sehr harten Realitäten der räumlichen
Bedingungen kämpfen. Oft ein aussichtsloser Kampf, weil er ja
gerade das voraussetzt, was man in diesen
tätigkeitseinschränkenden Bedingungen so schwer erwerben
und pflegen kann, nämlich reiche Phantasie und beharrliche
Eigenbestimmtheit des Handelns.
Ein Beispiel aus einer Untersuchung der deutschen Soziologin
Meyer-Ehlers. Wieviel Zeit verbringen die Familienmitglieder von
morgen bis abend innerhalb der Wohnung in den verschiedenen
Tätigkeiten? Meyer-Ehlers hat solche Zeitbudgets bei Bewohnern
von Blockwohnungen und Reiheneinfamilienhäuschen verglichen.
Dabei waren sowohl die Bewohner nach Einkommen. Beruf, Bildung und
andern Merkmalen wie auch die eigentlichen Wohnungen nach Raumzahl
und Grundfläche weitgehend gleich. Der einzige Unterschied lag
darin, dass in den Reihenhäuschen im Unterschied zu den
Blockwohnungen sogenannter Sekundärraum vorhanden war, d.
h. Raum ohne vorgeplante Funktion, also in der Wohnmaschine
überflüssiger Raum, der nur kostet, aber nichts bringt:
nämlich Keller, Estrich, Treppenhaus. Sie werden verblüfft
sein, wenn ich Ihnen aus den Ergebnissen einen gewichtigen
Unterschied herausgreife: Die Mitglieder der Familien in den
Blockwohnungen verbrachten im Tagesdurchschnitt über eine Stunde
mehr vor dem Fernseher als die Hausbewohner. Man kann vermuten, dass
das beschränkte Raumprogramm der Wohnungen die Bewohner zum
passiven Konsum bewog, während das Minimum an räumlicher
Vielfalt die Hausbewohner zu aktiven Tätigkeiten wie Basteln und
Spielen herausforderte.
Für ein zweites Beispiel fehlen die Untersuchungen; man kann
sie infolge Mangels an entsprechenden Objekten innerhalb einer
Sozialschicht kaum durchfuhren. Sie wissen, dass ältere,
bürgerliche Wohnungen und Einfamilienhäuser in der Regel
zwei Wohnzimmer aufweisen: eine Alltagsstube für die Familie und
ein gutes Zimmer oder Salon für das Feiern von Festen oder den
Empfang von Gästen. Man hat mit Recht festgestellt, dass der
Salon die meiste Zeit des Jahres leersteht und ihn daher als eine
überflüssige Investition aus den Raumprogrammen für
Wohnungen ausserhalb der Luxusklasse eliminiert. Die Betrachtung ist
rein quantitativ und verpasst daher die entscheidenden
Qualitäten des Raumprogramms mit dem Doppelwohnraum. Ich weise
auf ein paar solche Qualitäten hin und stelle zur Diskussion, ob
nicht vielleicht ihre Elimination ein bedenkliches Verpassen einer
Investitionschance ist. Ich denke bei diesen Erwägungen vor
allem an Familien mit Kindern. Ein zweites Wohnzimmer (übrigens
ähnlich auch eine Wohnküche) bringt eine beträchtliche
Strukturvermehrung in eine Wohnung: mit einem Mal sind innerhalb der
Familie zweierlei Tätigkeiten gleichzeitig möglich, ohne
dass man in die Privatbereiche der Familienmitglieder ausweichen
muss, also noch an der Gemeinschaft teilnehmen kann. Die Art der
Tätigkeiten kann durch die unterschiedliche Umgebung ihre
Färbung bekommen: alltäglicher oder eben ein bisschen
besonders. Wie kann jemand beispielsweise seinen Chef einladen, wenn
es nur eine enge Essnische im einzigen Wohnzimmer gibt? Wer nicht
über ganz besonders leichtfüssige soziale Kompetenz
verfügt, welche ihn hoffen lässt, die räumliche
Beschränkung überspielen zu können, wird es wohl
lieber bleiben lassen. Indem die Eltern kleinen Kindern
gegenüber den besseren Raum als «verbotene Zone»
erklären und sie mit zunehmendem Alter allmählich dort
einfuhren, nutzen sie eine treffliche Gelegenheit, zur Achtung
für die Welt des andern zu erziehen. Dies um so mehr, wenn sie
gleichzeitig umgekehrt zeigen können, dass sie ihrerseits einen
privaten, eigenen Bereich des Kindes mit dem Alter zunehmend
ebenfalls achten.
Das fuhrt mich zum dritten Beispiel räumlicher Strukturen und
ihrer Bedeutung innerhalb der Wohnung: der psychologischen Bedeutung
des Kinderzimmers. Es besteht heute weitherum Einigkeit, dass von
einem gewissen Alter an ein eigenes Zimmer beinahe ein Grundrecht
ist. Auch ich werte diaals einen Gewinn, den wir dem materiellen
Fortschritt verdanken. Ich schliesse aber die Frage an, ob wir nicht
auch hier ob dem quantitativen Gewinn das Qualitätsproblem aus
den Augen verloren haben. Typische Kinderzimmer sind klein (Bett,
Tisch, Stuhl, Schreibplatz für Aufgaben und, wenn's gut geht,
ein Quadratmeter Spielfläche); sie sind völlig unzureichend
isoliert gegen Schall, der aus dem Zimmer heraus oder ins Zimmer
hineindringt; und sie liegen innerhalb der Wohnung an einer
beliebigen Stelle. Typische Kinderzimmer schränken die
möglichen Tätigkeiten des Kindes in starkem Masse ein, wohl
noch stärker als die Wohnungsumgebung. Ich halte solche
Kinderzimmer für eine Fehlinvestition. Eigentlich verfehlen sie
aufjeder Altersstufe genau das, was das Kind vom räumlichen
Zentrum seiner Existenz erwarten könnte. Das kleine Kind wird im
kleinen Zimmer von seiner Mutter isoliert. Dem Vorschulkind erschwert
es das Zusammenspielen mit Geschwistern und anderen Kindern. Dem
Schulkind erleichtert es weder in ruhiger Abgesondertheit zu lesen
und zu denken, noch gibt es seinem Expansionshunger und
Tätigkeitsdrang den nötigen Raum. Für die
Heranwachsenden schliesslich ist das Kinderzimmer eine Katastrophe,
an der oft genug die ganze Familie schwer zu tragen hat. Ich meine,
dass dem Heranwachsenden und den Eltern keine räumliche
Unterstützung des notwendigen Ablösungsprozesses gegeben
wird, dadurch dass sein Zimmer praktisch mitten in der Familie liegt.
Die Folge ist, dass der Jugendliche entweder zu lange Kind bleibt
oder zu früh, wie man so sagt, auf die Strasse geht. Es scheint
mir nicht zufällig, dass sich die Jugendunrast der letzten Jahre
u. a. in der Forderung nach autonomen Jugendzentren manifestiert.
Vielleicht suchen die Jugendlichen ein räumliches Zentrum
für ihr Leben, das ihnen die Familienwohnung nicht geben
kann.
Mit den Familienwohnungen sind auch die Familien klein und
gleichartig geworden. Es ist schwer zu sagen, ob der Wohnungsbau der
Reduzierung der Familie nur nachgefolgt ist oder ob er sie mit
verursacht hat. Tatsache aber ist, dass wir jetzt die vielen kleinen
und gleichartigen Wohnungen haben und damit jeder Versuch einer
Familie, sich zu erweitern, schweren Hindernissen begegnet. Fast
unmöglich ist z. B. die Hereinnahme weiterer Personen wie
Verwandte, Betagte, Kameraden der Kinder, Behinderte, Personen aus
andern Gegenden usf. Damit solche Personen die Familie wirklich
bereichern können, damit die unvermeidlichen Konflikte eine
Chance haben, bewältigt zu werden, müssen sie ähnlich
wie die Heranwachsenden psychologisch-räumlich in sinnvoller
Distanz zur Familie leben können: zugleich zugehörig und
doch ausreichend getrennt, dass ihre Rollenbeziehung klar sichtbar
ist. Dazu braucht es etwas reichere räumliche Strukturen als die
typischen Drei- oder Vierzimmerwohnungen, in denen die
Zimmerkästchen reihum um ein Entree herum angeordnet sind: ich
denke z. B. an separate und halbseparate Zimmer und Zimmergruppen,
die je nach Bedarf vielleicht der einen, vielleicht der benachbarten
Wohnung zugeordnet werden können. Sogar die Mansarde
enthält etwas von dieser Idee.
Man könnte aber wesentlich weitergehen; und es gibt durchaus
Baufachleute, die sich einiges dazu einfallen lassen, manchmal durch
unnötige Bauvorschriften oder durch Geldgeber eingeengt, die nur
das schon Bekannte akzeptieren. Ich behaupte, dass sich das
Investieren in Wohnungsbau mit reicheren Baustrukturen auszahlen
wird. Nicht nur wird wahrscheinlich die höhere Wohnqualität
von zunehmend mehr Leuten gesucht werden. Es wird auch aller
Wahrscheinlichkeit nach das Verhältnis zwischen der
traditionellen Arbeitswelt und dem Lebensbereich des Wohnens sich
verändern, und zwar im Sinne einer stärkeren Durchmischung.
Am Beispiel der elektronischen Datenverarbeitung und anderer
Dienstleistungen ist bereits heute einiges davon zu beobachten. Es
ist schon bald nicht mehr ein technisches, sondern nunmehr ein
organisatorisches Problem, dass ein beträchtlicher Teil der
Arbeitsplätze wieder nahe bei den Familien eingerichtet werden
kann. Ich will aber nicht den Propheten machen, sondern nur darauf
hinweisen, dass wir uns die Entscheidung für oder gegen eine
stärkere Durchmischung von Arbeiten und Wohnen
offenhalten und nicht durch einen Mangel an geeigneten baulichen
Strukturen aus der Hand nehmen lassen sollten. Ich plädiere also
für einen Wohnungsbau, der eine offenere Familie
ermöglicht, sowohl was ihre personelle Zusammensetzung betrifft
wie auch bezüglich der Erweiterung von Tätigkeiten, die in
und in der Nähe der Familie stattfinden.
Anonymität, Isolation und Einsamkeit oder
soziale Kompetenz
Das fuhrt mich zurück zum Ausgangspunkt: vom Leben in der
Wohnung gibt es Wirkungen darüber hinaus. Beziehungen innerhalb
der Wohnung bilden die Grundlage der Kompetenz, mit dem andern
umzugehen.
Ich habe davon gesprochen, dass Innen und Aussen der Wohnung sehr
schroff voneinander getrennt sind. Die Wohnungstüre ist in
vielen Fällen eine schwer passierbare Grenze. Wie Untersuchungen
zeigen, ist dies um so mehr der Fall, desto grösser die Zahl der
im gleichen Haus lebenden Familien ist. Die Familie steht in der
Defensive und versucht sich ihr Refugium zu sichern, kann man
vermuten, weil so viele ihrer Aufgaben von andern gesellschaftlichen
Institutionen übernommen worden sind. Wiederum stützt der
Wohnungsbau diese möglicherweise für die Familie fatale
Rückzugstendenz. Nicht nur durch den Bau von einheitlichen und
abgeschlossenen Kästchen, die es fast unmöglich machen,
dass die Bewohner ihre Identität, wer sie sind und sein
möchten, nach aussen kund tun. Es gibt so etwas wie ein Gesetz
der mittleren Menge; das wird oft missachtet. Es scheint, dass
Menschen ein gewisses mittleres Mass an Information oder neuen
Eindrücken brauchen; sowohl zu wenig wie auch zu viel ist auf
die Dauer unerträglich belastend und wirkt sich aus. Allerdings
lange Zeit so subtil, dass man sich leicht täuschen kann. Doch
fuhrt letztlich beides zu Vereinsamung.
In diesem Zusammenhang möchte ich über eine Reihe von
Experimenten berichten, die zwar mit Studenten in Studentenwohnheimen
gemacht worden sind, aber wohl mit einiger Plausibilität auf das
Wohnen von Familien übertragen werden können. Die beiden
amerikanischen Psychologen Baum und Valins haben mit ihren
Mitarbeitern das soziale Verhalten von Studenten untersucht, die
entweder in Korridorzimmern oder in Appartementzimmern lebten. An der
gleichen Universität gab es Studentenheime mit gleich viel
Grundfläche pro Student, je 32-36 Studenten auf einem Stockwerk,
bei gleicher Ausstattung. Der einzige Unterschied zwischen den beiden
Wohnweisen bestand darin, dass im einen Fall die 17 Doppelzimmer
schön der Reihe nach an einem langen Korridor angeordnet waren,
am einen Ende Treppenhaus, ein Wohn- und Fernsehzimmer am andern und
Toiletten in der Mitte; im andern Fall waren je 3 Doppelzimmer um
eine kleine Diele mit zugeordneten Toiletten gruppiert. Das bedeutet,
dass ein «Korridorstudent», wenn er aus seinem
Zimmer tritt, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit einen oder
mehrere von 35 Kameraden antrifft, von denen er die meisten
natürlich nur oberflächlich kennen kann. Umgekehrt lebt der
«Appartementstudent» gewissermassen mit 5 Kameraden
in einer vertrauten Gemeinschaft zusammen: bevor er in die
Öffentlichkeit hinaustritt, passiert er die Diele und eine
weitere Türe; die Gewohnheiten der 5 Kameraden sind ihm
vertraut, egal ob er mit ihnen enger befreundet ist oder nicht; die
übrigen 30 Studienkollegen sind ihm ferner, bzw. er kann sich
mit einzelnen von ihnen nach seinen eigenen Wünschen befreunden
oder nicht. Durch diesen oberflächlich sehr einfachen
Unterschied in der Bauweise werden nun ausgesprochen deutliche
Unterschiede in der Lebensweise der beiden Studentengruppen erzeugt;
es ist geradezu unglaublich, was die beiden Forscher bisher in einer
ganzen Reihe von Untersuchungen herausgefunden haben. Beispielsweise
kann man beobachten, wie oft und wie lange die Studenten mit andern
in Kontakt treten: die Gesamtzahl der Kontakte war etwa ähnlich;
bei den Korridorstudenten wurden sie zu drei Vierteln im Korridor
beobachtet, und sie waren kurz und oberflächlich; der Wohnraum
wurde praktisch nur zum Fernsehen benutzt; bei den
Appartementstudenten hingegen waren drei Viertel der Kontakte in den
Dielen. Es scheint, dass die Korridorbewohner Orte meiden, wo sie mit
andern ins Gespräch kommen.
Interessant ist nun, dass die unterschiedliche Wohnweise, schon
wenige Wochen nach Semesterbeginn, weit über die Wohnsituation
hinaus Auswirkungen auf das gesamte Leben der Studenten hat.
Beispielsweise hat man die Studenten auch in einer arrangierten
Wartzimmersituation beobachtet: keine Unterschiede beim Alleinwarten;
beim Warten zu zweit setzen sich die Korridorstudenten weiter weg vom
andern als die Appartementstudenten, sie schauen ihn weniger an, und
sie sprechen fast dreimal seltener mit ihm; sie ziehen das
Blättern in einem Magazin vor. In Fragebogen geben sie auch
häufiger Gefühle des Unbehagens an, wenn das Warten beim
Zahnarzt ist.
Genauere Untersuchung zeigt, dass es nicht einfach die Gegenwart
der andern ist, die den Korridorstudenten Unbehagen macht, sondern
die Erwartung, dass man ,dem andern nicht ausweichen kann. Die
Ergebnisse insgesamt werden so verstanden: die Korridorstudenten
müssen infolge der baulichen Gegebenheiten zu viele soziale
Kontakte erleiden, über die sie keine Kontrolle haben; ihr
Sozialverhalten ist im Unterschied zu den Appartementstudenten
stärker aussenbestimmt. Als Reaktion darauf schränken sie
generell ihre Kontaktbereitschaft ein und meiden Orte, wo solche
wahrscheinlich sind.
Es gibt Gruppenspiele, wo man die Wahl hat, entweder im Wettbewerb
gegen den andern zu gewinnen (kompetitiv) oder Koalitionen zu bilden
und den gemeinsamen Gewinn zu erhöhen (kooperativ). Beobachtet
man die Studenten in solchen Spielen, so zeigt sich, dass die
Korridorstudenten am häufigsten kompetitiv, also gegeneinander
spielen, die Appartementstudenten jedoch am häufigsten
kooperativ, also miteinander. Bei den Korridorstudenten ist auch
gehäuft zu beobachten, dass sie sich aus dem Spiel
zurückziehen, sich nicht beteiligen.
Das sind Untersuchungen bei amerikanischen Studenten.
Übertragungen sind immer heikel. Aber ich denke, dass solche
Ergebnisse schon auch etwas von unserer Lebensweise beleuchten. Die
Käfighaltung - wenn ich es überspitzt formulieren darf -
macht die Menschen hilflos und inkompetent zum Zusammenleben. Es ist
wichtig zu sehen, dass sich die Studenten dieser Tatsache kaum
bewusst sind. Und das ist auch bei uns bei Bewohnern grosser
Blöcke so. Ich habe schon gesagt, dass auf Befragen die meisten
Bewohner solcher Quartiere angeben, dass sie sich dort wohl
fühlen. Viele sagen, dass es eben gerade die Anonymität
ist, die sie suchen und dort tinden; dass sie nicht jeder Nachbar
kennt und dass sie sich selber nicht um jeden Nachbarn kümmern
müssen. Sie kennen das Sprichwort von den sauren Trauben: ob
diese Leute nicht aus ihrer sozialen Not eine Tugend zu machen
versuchen?
*Soweit einige Beispiele aus der sozialwissenschaftlichen Forschung
über das Wohnen sowie einige Vermutungen im Anschluss daran. Ich
möchte nun zum Abschluss meiner Ausführungen einige
wesentliche Punkte in Thesenform zusammenfassen und kurz
kommentieren:
1. Die Wohnung ist das Gefäss für die Familie oder der reale Ort ihrer Existenz. Jede kulturelle Gegebenheit braucht zur Sicherung ihrer Existenz einen realen, materiellen Träger. Eine Idee ist dann stark, wenn sie aufgeschrieben werden kann, wenn es ein Symbol gibt, in dem sie sich immer wieder gut erkennbar manifestiert. Das Individuum, die menschliche Person verfügt über den Organismus als unzweifelhaften Träger seiner Existenz. Die Familie als eine sozio-kulturelIe Institution hat nur schwache real-konkrete Träger etwa im Familienrecht oder in den Traditionen; ein jahrhundertelang sehr wirksamer Träger, die Institution der Ehe, hat eine gefährdete Zukunft. Die Wohnung könnte für die Familie sein, was der Organismus für die Person ist: ein Gefäss, ein Träger ihrer Existenz. Wie man den Körper pflegt, übt, verschönert, verbessert, sollte man durch die Kultivation der Wohnung aktiv zur Verbesserung der Familie beitragen.
2. Durch bestimmte Bauweisen und Bauformen beeinflussen wir das Verhalten und die Entwicklung der Familie und der Individuen in bestimmter Weise; wir haben Entscheidungen zu treffen, ob wir Bauformen bevorzugen, welche das Individuum und die Familie in ihrer Eigenständigkeit stärken oder schwächen.
Ich bin hier etwas kühn mit meiner Behauptung. Und ich steche zweifellos in ein Wespennest. Letzten Endes rüttle ich am Fundament des gesamten Bauwesens, wenn ich mich dafür einsetze, dem Bewohner möglichst viel Autonomie in der Gestaltung, Planung, Ausführung und Verwaltung seiner Behausung zuzugestehen. Weder die Wohnbaufachleute noch die Sozialwissenschaftler des Wohnens wissen, was eine gute Wohnung ist, weil das letzten Endes auf die Bewohner ankommt. Die Wohnung ist auch nie fertig, solange sie von Menschen bewohnt wird, die sich entwickeln von der Kindheit bis ins Alter; sie darf nie, fertig sein, sonst mach sie die Bewohner fertig. Die Wohnung ist eben nicht nur in finanzieller Hinsicht ein Investitionsgut, sondern auch im Hinblick auf ihre Bedeutung für das Leben und das Zusammenleben. Man muss ihren besonderen "instrumentellen" Charakter mehr und mehr herausstellen. Ich finde mich aber durchaus in Übereinstimmung mit unseren demokratischen Idealen, wenn ich die Eigenständigkeit des Wohnens der kleinen Gruppe, insbesondere der Familie fordere. Denn die Familie steht wie keine andere Institution des menschlichen Lebens im Schnittpunkt zwischen Individuum und Gesellschaft. Sie verkörpert und lehrt zugleich Eigenständigkeit und Solidarität.
3. Wohnen ist eine anspruchsvolle Tätigkeit. Sie umfasst Wirken auf die Welt und Rückwirken der Welt auf den Menschen. Wohnen will gelernt sein.
Wohnen geht nicht von selbst. Nicht nur müssen Voraussetzungen von Seiten der räumlichen Strukturen gegeben sein, in der Wohnung und darum herum, die jetzt nicht immer ausreichend sind. Es ist auch unumgänglich, dass die wohnenden Menschen diese Tätigkeit als eine anspruchsvolle Tätigkeit verstehen und sich dafür ausreichend vorbereiten. Ich bezweifle, dass die eigenen Kindheitserfahrungen, oft unter ungünstigen Bedingungen erworben, dafür ausreichen. Es ist aber nicht einzusehen, warum unser Bildungssystem so einseitig auf die Förderung der Arbeitswelt orientiert ist, und auch dann, wenn es sich Teiltätigkeiten des Wohnens widmet, die Leistungen in den Vordergrund stellt: das Kochenkönnen, das Putzenkönnen, das Flickenkönnen.
Ich glaube, dass wir die «Kompetenz zu wohnen»
als einen Bestandteil der Grundbildung des Menschen verstehen
sollten. Konkret schlage ich vor, den traditionellen
Hauswirtschaftsunterricht, dessen Reform ja im Gange ist, in Richtung
«Verbesserung der Befähigung zu sinnvollem Wohnen» zu
verändern. Das Wohnbauwesen und noch mehr die
Einrichtungsindustrie spiegeln den Leuten das Wohnen als einen
Konsumbereich vor. Diese fatale Tendenz sollte neutralisiert werden
durch eine Stärkung der Individuen und Familien, welche
befähigt zum Urteil und zur freien Wahl. Der Vorbereitung von
Lehrern für das Wohnen ist ganz besondere Sorgfalt zu widmen.
Sinnvolles Wohnen kann nicht als Auftrag an irgendwelche Fachleute
delegiert werden. Es geht uns vielmehr alle an. Die Verbesserung des
Wohnens ist deshalb in erster Linie eine pädagogische
Aufgabe.
*Ich bin davon ausgegangen, dass weit verbreitet ein Unbehagen
besteht über unser heutiges Wohnen. Und das hat in letzter Zeit
deutlich zugenommen. Seit dem Zweiten Weltkrieg hat sich aber die pro
Person verfügbare Wohnfläche in der Schweiz, insbesondere
in den Städten, nahezu verdoppelt. Dennoch spricht man
allenthalben von «Wohnungsnot». Unser Zoodirektor, das
Bauwesen, scheint uns nicht eine gebaute Umwelt anzubieten, in der
wir zu unserer eigenen Befriedigung gedeihen. Könnte es sein,
dass wir aus dem dumpfen Gefühl heraus, von unseren Wohnungen
das nicht zu bekommen, was wir von ihnen erwarten, nach immer mehr
Wohnfläche rufen? So wie jemand, der sich einseitig
ernährt, immer mehr isst, um wenigstens ein bisschen von dem zu
bekommen, was ihm fehlt.
Ich weiss keine sichere Antwort. Aber ich hoffe, Ihnen gezeigt zu
haben, dass mit Hilfe des sozialwissenschaftlichen
«Mikroskops» einige Zusammenhänge zwischen Wohnen,
Bauen und Leben durchsichtiger geworden sind. Noch stehen wir erst am
Anfang solcher Einsichten. Es ist aber schon deutlich geworden, dass
das Wohnbauwesen in begreiflicher Kurzsichtigkeit zu sehr das Gebaute
und zu wenig den Menschen im Gebauten in Betracht gezogen hat.
Die zunehmende Verbreitung des Wissens um diese Zusammenhänge
wird immer mehr Menschen erlauben, klüger zu wählen und
bewusster zu wohnen, mit der gestalteten Umwelt erwünschte
Wirkungen zu erzielen und unerwünschte Nebenwirkungen zu
vermeiden. Dieses Wissen wird, wenn es von den Wohnbaufachleuten
übernommen wird, allmählich auch dazu beitragen, dass eine
anders gebaute Welt besseres Wohnen erleichtert. Da Gebautes in der
Regel einige Zeit überdauert, darf man nicht zu rasche
Auswirkungen erwarten. Um so mehr sollten wir uns beeilen!
Ausgewählte Literatur zum
Thema
Baum, A., & Valins, S. (1977): Architecture and social
behavior: psychological studies of social density. Hillsdale N. J.,
Erlbaum, 1977.
Baumann, R., & Zinn, H. (1973): Rindergerechte Wohnungen
für Familien. Eidg. Forschungskommission Wohnungsbau,
Schriftenreihe Wohnungsbau, Nr. 23d. Bern, EDMZ
Conway, D. J. (Ed. 1977): Human response to tall buildings.
Stroudsburg Pa., Dowden-Hutchinson-Ross, 1977.
Herlyn, U. (1970): Wohnen im Hochhaus: eine
empirisch-soziologische Untersuchung in ausgewählten
Hochhäusern der Städte München, Stuttgart, Hamburg und
Wolfsburg Stuttgart, Krämer, 1970.
Lauwe, P. C., de, & Lauwe, M. C., de (1960): Famille et
habitation. Paris, C. N. R. S., 2e ed. 1967.
Meyer-Ehlers, G. (1968): Wohnung und Familie. Stuttgart, Deutsche
Verlagsanstalt, 1968.
Mühlich, E., Zinn, H., Kröning, W., &
Mühlich-Klinger, 1. (1978): Zusammenhang von gebauter Umwelt und
sozialem Verhalten im Wohn- und Wohnumweltbereich. Bonn,
Schriftenreihe «Städtebauliche Forschung» des
Bundesministers für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau,
Nr.03.062,1978,186 p.
Newman, 0. (1972): Defensible space. New York, MacMillan,
1972.
Niethammer, Lutz (Ed. 1979): Wohnen im Wandel: Beiträge zur
Geschichte des Alltags in der bürgerlichen Gesellschaft.
Wuppertal, Hammer, 1979,431 p.
Top of Page